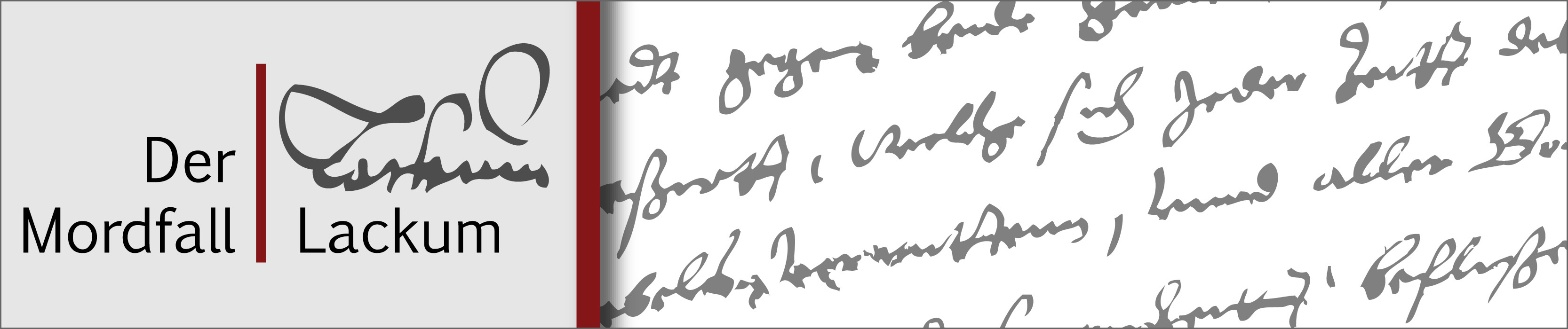Injurienprozesse am Reichskammergericht - Ziel und Inhalt der Realinjurienklage im Fall Lackum
von Isabel Neuberth
Das Reichskammergericht
Das 1495 gegründete Reichskammergericht stellte in der Frühen Neuzeit neben dem Reichshofrat die höchste Gerichtsbarkeit für Untertanen des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation dar. Die Zuständigkeit des Reichskammergerichts war vor allem in zivilrechtlichen Angelegenheiten gegeben, wobei zwischen zwei Verfahrensarten unterschieden wurde.1 Zum einen gab es den erstinstanzlichen ordentlichen Zivilprozess, der es reichsunabhängigen Personen und Städten, die keinem anderen Gericht unterstanden, und Angehörigen des Gerichts ermöglichte, ihre Angelegenheiten zu verhandeln.
Zum anderen gab es den Appellationsprozess, ein zweitinstanzliches Verfahren, mit dem die Überprüfung der Urteile der Vorinstanzen durch Berufung erreicht werden sollte.
In strafrechtlichen Angelegenheiten konnte das Reichskammergericht nur dann angerufen werden, wenn gegen elementare Grundsätze des Prozessrechtes verstoßen worden war. Hierbei handelte es sich um sogenannte Nichtigkeitsklagen. Des weiteren wurden Mandatsprozesse, also Verfahren bei denen durch ein strafbewehrtes Gebot Handlungen oder Unterlassungen gefordert wurden,2 vor dem Reichskammergericht geführt.
Der römisch- rechtliche Injurienprozess
Eine Injurienklage führte zum Injurienprozess, einem Verfahren, das nach bestimmten Regeln abzulaufen hatte. Die aus der römischen Rechtsprechung entstammenden und im Corpus Iuris Civilis verankerten Klagen waren vor allen Dingen Bußklagen wegen der Missachtung fremder Persönlichkeit3 und behandelten, wie der Name Injurien (abgeleitet vom lateinischen Begriff „iniuria“) nahe legt, Ehrschädigungen durch Beleidigungen und Ungerechtigkeiten.
Im Zuge der Rezeption des römischen Rechts wurde in der Frühen Neuzeit diese Klageform des Injurienprozesses häufig angewendet und konnte sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Folgen haben.4 So konnten zum Beispiel Gefängnisstrafen, Pranger und Landesverweis auf der einen und Widerrufe und Geldstrafen auf der anderen Seite aus einer Injurienklage resultieren.
Grundsätzlich lassen sich mehrere Arten von Injurienklagen unterscheiden, von denen zwei die wichtigsten darstellen: Der Prozess gegen eine Verbalinjurie, eine Beleidigung und Ehrverletzung durch Aussagen, konnte außer dem Ziel der Wiederherstellung der Ehre auch die Absicht haben, dem erhobenen Vorwurf einer strafbaren Handlung entgegenzuwirken,5 indem der Verleumder beklagt und die Unschuld des Klägers nachgewiesen wurde. Die andere häufigste Form der Injurienklage wurde gegen die sogenannte Realinjurie, eine Ehrverletzung durch tätliche Handlungen, zumeist mit der Folge eines körperlichen Schadens, eingeleitet. So gehörten zu den Realinjurien die Anwendung von Gewalt, wie etwa Faustschläge und andere Verletzungen, und die unrechtmäßige Gefangennahme. Wie der Fall Lackum deutlich macht, konnte unter Umständen aber auch eine unrechtmäßige Hinrichtung darunter verstanden werden.6
Injurienprozesse gegen die Obrigkeit
Für die Untertanen des Reiches gab es neben den Klagen gegen andere Untertanen somit auch die Möglichkeit der Injurienklage gegen die Obrigkeit, zum Beispiel gegen Richter und Gerichte im Fall einer unrechtmäßigen Gefangennahme, peinlicher Tortur oder Tod in der Haft vor dem Reichskammergericht. So schrieb 1596 einer der Prokuratoren am Reichskammergericht, Andreas Pfeffer, dass es sogar üblich war, Richter durch Injurienprozesse zu belangen.7 Es ist allerdings davon auszugehen, dass die meisten derartigen Injurienprozesse erst nach der Hinrichtung oder dem Tod des Opfers von den Angehörigen vor das Gericht gebracht wurden, damit das Reichskammergericht darüber entscheiden konnte, ob die Vorinstanzen „wohl“ oder „übel“ geurteilt hatten.8
Fragt man allgemein nach den Erfolgschancen des Injurienprozesses, so kann man sehen, dass diese stiegen, wenn der Kläger in der Gesellschaft angesehen war und Zeugen vorweisen konnte, die seine Ehre und sein Ansehen bezeugen konnten, beziehungsweise seine Unschuld beweisen konnten.9 So war es Prozessstrategie der Kläger anhand von Zeugen das Verdachtsmoment gegen sich selbst zu entkräften. Im Gegenzug versuchte der Beklagte, diesen Verdacht zu bekräftigen und zu beweisen.10
Durch den hohen finanziellen Aufwand bedingt, wurden Injurienklagen nur bei schweren Ehrschädigungen oder bei guter Aussicht auf Erfolg angestrebt und ansonsten andere Formen der Wiederherstellung der Ehre, wie etwa Brüchtenverfahren, gewählt.
Die Injurienklage im Fall Lackum
 Im Fall Lackum wurde durch die Witwe Agnes Lackum und ihre Kinder Dietrich und Christine eine Realinjurienklage gegen die fürstliche Regierung ( die kleve- märkischen Räte), den Drosten des Amtes Wetter und die Richter von Wetter und Hagen wegen erlittener Schmach und Schande eingereicht.11 Die Familie forderte eine Entschädigungszahlung von 40.000 Goldgulden von den Beklagten. Als Begründung nannte die Familie den Tod des Anton Lackum, der durch die unangemessenen Haftbedingungen krank geworden sei und über dessen Krankheit und Tod die Familie erst spät in Kenntnis gesetzt worden sei. Auch sei Georg Lackum unschuldig und unrechtmäßig hingerichtet worden, weswegen er zur Wiedererlangung der Ehre ein christliches Begräbnis bekommen solle. Außerdem hätte der Drost Dietrich Lackum ohne Grund angegriffen und dessen Ehre verletzt, weswegen seine Frau ihr Kind verloren hätte. Der Drost solle für diese Ehrverletzung nochmals 5.000 Goldstücke zahlen. Des weiteren sei der Verdächtige Jasper von der Ruhr freigelassen worden, was der Familie Spott und somit weitere Ehrverletzungen eingebracht hätte.
Im Fall Lackum wurde durch die Witwe Agnes Lackum und ihre Kinder Dietrich und Christine eine Realinjurienklage gegen die fürstliche Regierung ( die kleve- märkischen Räte), den Drosten des Amtes Wetter und die Richter von Wetter und Hagen wegen erlittener Schmach und Schande eingereicht.11 Die Familie forderte eine Entschädigungszahlung von 40.000 Goldgulden von den Beklagten. Als Begründung nannte die Familie den Tod des Anton Lackum, der durch die unangemessenen Haftbedingungen krank geworden sei und über dessen Krankheit und Tod die Familie erst spät in Kenntnis gesetzt worden sei. Auch sei Georg Lackum unschuldig und unrechtmäßig hingerichtet worden, weswegen er zur Wiedererlangung der Ehre ein christliches Begräbnis bekommen solle. Außerdem hätte der Drost Dietrich Lackum ohne Grund angegriffen und dessen Ehre verletzt, weswegen seine Frau ihr Kind verloren hätte. Der Drost solle für diese Ehrverletzung nochmals 5.000 Goldstücke zahlen. Des weiteren sei der Verdächtige Jasper von der Ruhr freigelassen worden, was der Familie Spott und somit weitere Ehrverletzungen eingebracht hätte.
Hier wird deutlich, dass die Ehre für frühneuzeitliche Bürger von großer Bedeutung war. Agnes Lackum wollte mit ihrer Klage nicht nur die Ehre der lebenden Familienmitglieder retten, sondern auch die der Verstorbenen. Zum einen zeigt dies die Verbindung zwischen individueller und gruppenspezifischer Ehre, zum anderen die Bedeutung der Ehre über den Tod hinaus.12
Die Besonderheit der Injurienklage der Familie Lackum liegt darin, dass das Reichskammergericht direkt damit betraut wurde. In diesem Rahmen wurde auch der Aspekt der Nichtigkeit im Strafverfahren gegen Georg und Anton Lackum angesprochen. Das Reichskammergericht entschied sich, am 4. Dezember 1593 eine Citatio (Ladung) wegen der Injurienklage ausgehen zu lassen.13 Damit mußten Räte, Drost und Richter als Vertreter der territorialen Obrigkeit ihr Handeln rechtfertigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Untertanen im Reich Injurienklagen als eine wirkungsvolle Möglichkeit ansahen, um Ehrschädigungen sowohl durch verbale als auch reale Angriffe entgegenzuwirken. Ebenso versuchten sie dabei, sich gegen Ungerechtigkeiten im Strafvollzug zu wehren. Dass das Reichskammergericht den Klägern im Fall Lackum zunächst entgegenkam, kam aber keinem endgültigen Urteil gleich. Das Verfahren sollte noch über Jahre schweben.
1 Scheurmann, Ingrid: Organisation des Reichskammergerichts, in: Frieden und Recht. Das Reichskammergericht von 1495 bis 1806, Mainz, 1994, S. 118.
2 Oestmann, Peter: Hexenprozesse am Reichskammergericht, Köln, Weimar, Wien 1997, S. 73. (im Folgenden zitiert als: Oestmann, 1997)
3 Oestmann, 1997, S. 58.
4 Oestmann,1997, S. 58.
5 Oestmann, 1997, S. 58.
6 Fuchs, Ralf- Peter: Um die Ehre. Westfälische Beleidigungsprozesse vor dem Reichskammergericht 1525-1805, (Forschungen zur Regionalgeschichte 28) Paderborn 1999, S. 152. (im folgenden zitiert als: Fuchs, 1999)
7 Oestmann, 1997, S. 59.
8 Oestmann, 1997, S. 59.
9 Fuchs, Ralf- Peter: Der Vorwurf der Zauberei in der Rechtspraxis des Injurienverfahrens. Einige Reichskammergerichtsprozesse westfälischer Herkunft im Vergleich, in: ZNR 17, S. 29.
10 Fuchs, Ralf- Peter: Hexerei und Zauberei vor dem Reichskammergericht, Wetzlar 1994, S. 39ff.
11 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 1, fol. 21ff. (auch folgende Inhalte der Injurienklage an dieser Stelle)
12 Fuchs, 1999, S. 270.
13 „copia mandati de relaxandis bonis cum citatione, necnon Mandato de non offendendo pendentelite. Item compulsoriales & citatio super iniuriis” LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 1, fol. 1ff.