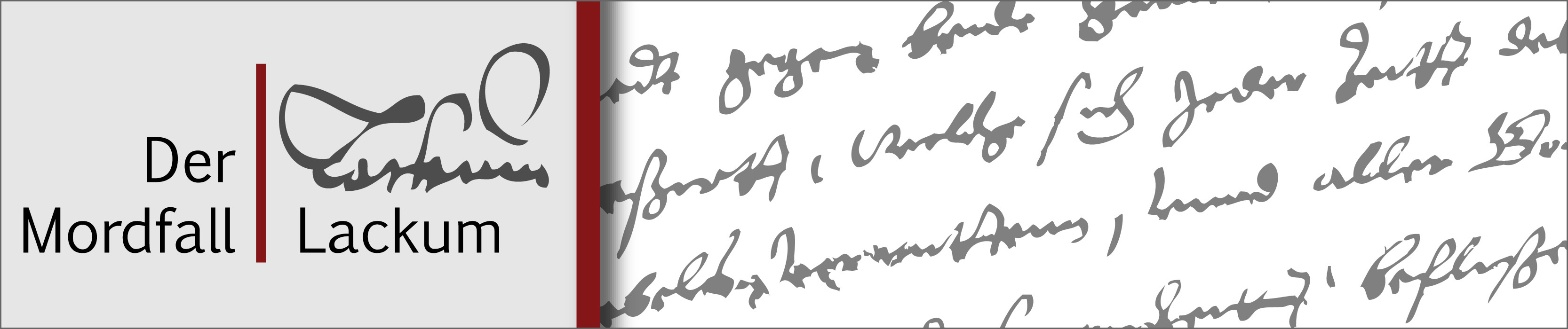Das Gefängnis in der frühen Neuzeit – Tod eines Gefangenen
von Tim Scholz
Das Gefängnis und seine Funktion in der frühen Neuzeit
Über das Gefängnis im 16. Jahrhundert ist nur wenig bekannt. Es gibt nur sehr wenige Quellen. Erst im 18. Jahrhundert finden wir systematische Beschreibungen über Gefängnisse. Diese befassen sich allerdings mit den so genannten Zucht- und Arbeitshäusern, die keine Untersuchungsgefängnisse waren.1
Im 16. Jahrhundert befanden sich Gefängnisse oftmals in Stadttürmen und administrativen Gebäuden, wie zum Beispiel Rathäusern.2 Allgemein wurde das Einsperren im Turm oder Kerker zum Beispiel bei Bannbruch oder Ketzerei verhängt, aber auch wenn man Schulden hatte und diese nicht begleichen konnte. Gefangene wurden nur selten in Türmen oder Kerkern eingesperrt, um sie zu bestrafen.3 Aus den Berichten von Gerichtsverwaltern erfahren wir, dass die Haftbedingungen oft sehr gesundheitsschädlich waren und der Zustand der Gefängnisse oft ein Grund für den Tod eines Gefangenen darstellte.4 Selbst Juristen beklagten sich im 16. Jahrhundert über die unhaltbaren Zustände der Gefängnisse.5 Die Räume, in denen die Gefangenen untergebracht wurden waren feucht, kaum beheizt und oft fiel wenig Licht herein. Auch die Frischluftversorgung war mangelhaft; insbesondere dann, wenn das Gefängnis zum Beispiel unter der Erde lag. Diese unzumutbaren Haftbedingungen waren allerdings kein Teil von Verhör- und Folterpraxis.
Selbst Juristen beklagten sich im 16. Jahrhundert über die unhaltbaren Zustände der Gefängnisse.5 Die Räume, in denen die Gefangenen untergebracht wurden waren feucht, kaum beheizt und oft fiel wenig Licht herein. Auch die Frischluftversorgung war mangelhaft; insbesondere dann, wenn das Gefängnis zum Beispiel unter der Erde lag. Diese unzumutbaren Haftbedingungen waren allerdings kein Teil von Verhör- und Folterpraxis.
Die meisten Gefängnisse befanden sich also in einem miserablen Zustand, waren zumeist einsturzgefährdet und boten durch ihren Bauzustand leichte Möglichkeiten zur Flucht. Oft wurde beklagt, dass zu wenige Gefängnisse zur Verfügung standen. Vor allem in kleineren Städten oder auf dem Land war das der Fall. Entweder wurdendie Gefangenen dann an andere Gerichte übergeben oder man bediente sich eines Ersatzes. Alltägliche Orte, wie zum Beispiel Gasthöfe, oder sogar das Haus des Gefangenen, konnten so zu Gefängnissen umfunktioniert werden. Solche verbesserten Haftbedingungen wurden bei adligen Menschen oftmals bevorzugt. Das Gefängnis war also der „Aufbewahrungsort“ für den Gefangenen bis zum Tag des Verfahrens.
Im Zentrum des frühneuzeitlichen Strafprozesses stand die Untersuchungshaft. Mit der Inhaftierung von Schuldigen sollte in erster Linie bewirkt werden, dass man nicht fliehen konnte. Die einzelnen Bedingungen der Untersuchungshaft waren vom Status des Gefangenen abhängig. Für den Adel wurde zum Beispiel noch im 16. Jahrhundert eine Sonderstellung gefordert. Wahrscheinlich hat es sich hier aber nur um Forderungen einzelner Personen gehandelt, da sich in den Quellen der frühen Neuzeit kaum noch Hinweise auf eine tatsächliche Sonderstellung sozialer Gruppierungen finden lassen.6
Eine massenhafte Unterbringung im Gefängnis fand erst später im 18. Jahrhundert statt. Hier stand der Besserungsaspekt, die Sozialisierung der Gefangenen, im Vordergrund. Nach Foucault wurde das eigentliche Gefängnis, wie wir es kennen, deshalb erst im 18. Jahrhundert geboren, als Häftlinge als Arbeitskräfte eingesetzt wurden.7
Erste Entwicklungen in Richtung Besserungsanstalten in Form der Arbeits- und Zuchthäuser gab es aber auch schon im 16. Jahrhundert. Auslöser für diese Entwicklung waren gesellschaftliche Probleme8 die immer mehr als Bedrohung aufgefasst wurden, wie Armut oder Vagabundentum.9 Durch die Leibes- oder Todesstrafe konnte man diese Probleme nicht lösen. So entwickelten sich letztendlich nach dem Vorbild des Londoner Zuchthauses Bridewell, welches bereits 1555 gegründet wurde, sowie des Amsterdamer Zuchthauses von 1595, auch in Deutschland die Zucht- und Arbeitshäuser.10 Im Zentrum des Strafprozesses stand nun die Besserung der Gefangenen durch schwere Arbeit und Zucht. Ferner gab es auch Unterricht und Seelsorge, um die Gefangenen wieder in die Gesellschaft einzugliedern und zu resozialisieren.11
Der Stock
 Eine sehr charakteristische Eigenschaft des Gefängnisses in der frühen Neuzeit war der so genannte Stock. Dabei handelt es sich um einen schweren Holzblock der aus zwei Hälften bestand. Er diente dazu, die Füße, Hände und manchmal sogar den Hals des Gefangenen fest zu halten. Oftmals wurde der Stock auch unter freiem Himmel angewandt. Die beiden Hälften des Stockes wurden zusammengeschlagen und lagen durch Zapfen aufeinander. Es gab ganz verschiedene Formen des Stockes. Es gab zum Beispiel Stöcke, in die ausschließlich die Füße des Gefangenen gelegt wurden; der so genannte Beinklotz, der dem Gefangenen eine schlechtere Fortbewegung ermöglichte, sowie Stöcke für die Hände und den Hals. Der Daumenstock war eine Foltermethode die die Daumenschraube ersetzte. Hierbei handelte es sich um ein Brett mit Stacheln, in das der Daumen eingeschlossen wurde. Der Stock hatte den Sinn der Abschreckung vor dem Gefängnis bzw. vor Haftstrafen.12
Eine sehr charakteristische Eigenschaft des Gefängnisses in der frühen Neuzeit war der so genannte Stock. Dabei handelt es sich um einen schweren Holzblock der aus zwei Hälften bestand. Er diente dazu, die Füße, Hände und manchmal sogar den Hals des Gefangenen fest zu halten. Oftmals wurde der Stock auch unter freiem Himmel angewandt. Die beiden Hälften des Stockes wurden zusammengeschlagen und lagen durch Zapfen aufeinander. Es gab ganz verschiedene Formen des Stockes. Es gab zum Beispiel Stöcke, in die ausschließlich die Füße des Gefangenen gelegt wurden; der so genannte Beinklotz, der dem Gefangenen eine schlechtere Fortbewegung ermöglichte, sowie Stöcke für die Hände und den Hals. Der Daumenstock war eine Foltermethode die die Daumenschraube ersetzte. Hierbei handelte es sich um ein Brett mit Stacheln, in das der Daumen eingeschlossen wurde. Der Stock hatte den Sinn der Abschreckung vor dem Gefängnis bzw. vor Haftstrafen.12
Die Rolle und Funktion des Gefängnisses im Fall Lackum
Im 16. Jahrhundert stellte das Gefängnis lediglich einen Behelf dar, um Straftäter unterzubringen und bis zum Verfahren zu verwahren. Auch im Mordfall Lackum kann man nur von einem Behelf sprechen. Hier scheint das Gefängnis in erster Linie dazu gedient zu haben Georg und Anthon Lackum voneinander zu trennen, indem man sie beide jeweils in einem anderen Gefängnis inhaftierte, um so schneller ein Geständnis zu erlangen.
Aus den Akten des Reichskammergerichtes geht hervor, dass der Drost zu Wetter Angst hatte, für den Tod Anthons zur Verantwortung gezogen zu werden. Deshalb wollte er sich dieser Verantwortung entziehen und das Verfahren zum Tod Anthons so schnell wie möglich beenden. Bereits am 13. Januar 1592 bestätigte er, dass Anthon Lackum im Gefängnis gestorben sei. Drei Tage zuvor habe ein Diener dem Gefangenen seine Mahlzeit bringen wollen und entdeckt, dass der Gefangene sich nicht mehr bewegen konnte. In den Akten wird beschrieben, dass der Mund des Verstorbenen offen, sein Körper steif und gekrümmt war und er schon gestunken habe. Zuerst sei Anthon allerdings zum Feuer gebracht worden um ihn zu wärmen, in der Hoffnung ihn doch noch wiederbeleben zu können. Kurz darauf sei er aber gestorben. Der Richter habe den Tod festgestellt. Für den Drosten zu Wetter war der Tod ein Beweis dafür, dass beide, Georg und Anthon Lackum, des Mordes schuldig gewesen waren.
Nach Anthons Tod kam der Verdacht eines Verstoßes gegen die klevische Polizeiordnung auf. Deswegen wurde eine Kommission einberufen, die den Vorfall untersuchen sollte. An der Spitze dieser Kommission stand der Richter von Hamm und der Richter von Schwerte.
Immer wieder hat der Drost zu Wetter seine Maßnahmen in Bezug auf Anthon und die Zustände seiner harten Haftbedingungen gerechtfertigt. Aus der Akte geht hervor, dass er zuletzt am 2. April 1592 nochmals seine Maßnahmen rechtfertigte und sich einvernehmlich mit den klevischen Räten erklärte. Erst am 5. Juli 1592 wurde der Richter zu Schwerte, Matthias Becker, als Kommissar eingesetzt. Unter seiner Leitung sollte der Vorfall genau überprüft werden.13
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die schweren, unmenschlichen Haftbedingungen, die oftmals in den Gefängnissen der frühen Neuzeit geherrscht haben, auch im Mordfall Lackum ein Grund für den Tod Anthons gewesen zu sein scheinen.
1Ludwig, Ulrike: Untersuchungshaft im Strafverfahren. In: Lexikon zur Geschichte der Hexenverfolgung, hrsg. v. Gudrun Gersmann, Katrin Moeller und Jürgen-Michael Schmidt, in: historicum.net. [URL: http://www.historicum.net/no_cache/persistent/artikel/5724/] (05.07.2009) (im Folgenden zitiert als: Ludwig, 2009). und
Falk Bretschneider: Gefangene
Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in Sachsen im 18. und 19.
Jahrhundert, Konstanz 2008.
2Ludwig, 2009.
3Schild, W.: Art. Gefängnis, in: LexMa, Bd. 4, (1989), Sp. 1168-1169.
4Ludwig, Ulrike: Untersuchungshaft im Strafverfahren. In: Lexikon zur Geschichte der Hexenverfolgung, hrsg. v. Gudrun Gersmann, Katrin Moeller und Jürgen-Michael Schmidt, in: historicum.net. URL: http://www.historicum.net/no_cache/persistent/artikel/5724/ (05.07.2009)(im Folgenden zitiert als: Ludwig 2009/2).
5Ludwig, 2009/2.
6Ludwig, 2009/2.
7Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M. 1976, S. 295-397.
8Hinckeldey, Ch.: Justiz in Alter Zeit, Rothenburg 1989 (im Folgenden zitiert als: Hinckeldey, 1989), S. 350-352.
9Henze, Martina: Art.: Gefängnis, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 4, (2006), Sp. 242-244.
10Hinckeldey, 1989, S. 350-352.
11Lieberwirth, R.: Art. Freiheitsstrafe, in: HRGI, Bd. 1, (1922-1925), Sp. 1238-1240.
12Grimm Deutsches Wörterbuch (Onlinewörterbuch). Suchbegriffe: Stock, Gefangenenstock.
13 LAV NRW W, RKG L 57, fol. 145 ff.