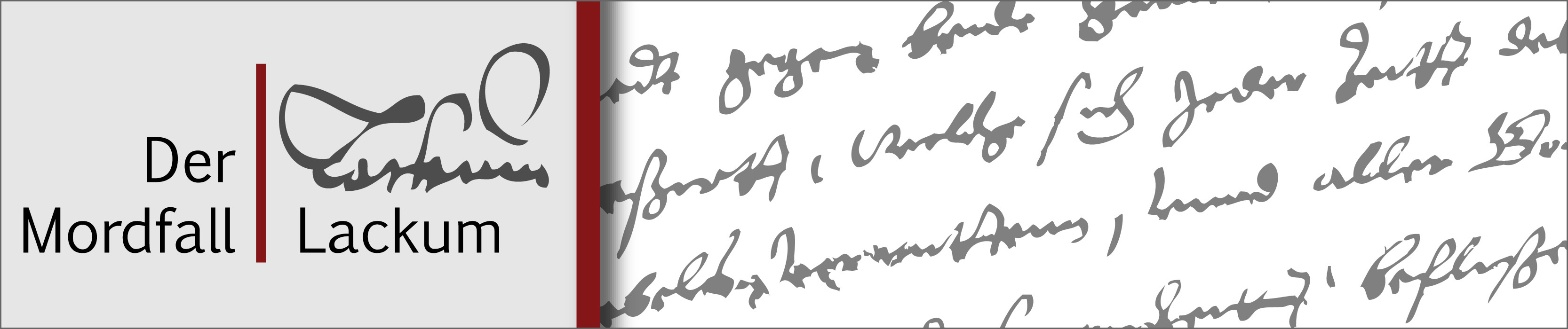Eine Hinrichtung auf der Boeler Heide
von Ariane Czeczor
Widerruf der Geständnisse und erneute Folter
Nach dem Widerruf der Geständnisse durch Georg und Anton Lackum auf dem Peinlichen Gerichtstag vom 20. November 1591 plädierte das Amt Wetter über den Urteilssprecher, „Printz zu Langerfeld“, zunächst auf einen Aufschub der Urteilsvollstreckung von einem Monat. Die Klevischen Räte ordneten daraufhin am 28. November eine erneute Tortur an. In einem weiteren Schreiben vom 9. Dezember 1591 drängten sie schließlich auf ein schnelles Verfahren mit baldiger Hinrichtung, da die Kosten nicht mehr tragbar seien1. Zwei Tage später antwortete Drost Bernhard von Romberg auf das Schreiben der Räte: Nach der Androhung einer weiteren Folter hätten die Gefangenen erneut gestanden2.
Die Hinrichtung Georg Lackums am 11. Dezember 1591
 Die Anwaltsschrift dokumentiert den Verlauf der Hinrichtung: Georg Lackum wurde hinaus auf die Richtstätte der Boeler Heide geführt. Nachdem der Scharfrichter ihm befohlen hatte niederzuknien, bat der Verurteilte darum, öffentlich zu beten und der Gemeinde etwas vortragen zu dürfen. In seiner Rede an das umstehende Volk und den Richter nahm er sein Schicksal zwar willentlich an, verkündete aber, daß er die Tat nicht begangen hatte. Er schwor, dass er an dem Mord keine Schuld trug: “will aber den thodt daruff nhemen, daß ich deß Johentgens bloett kheine schuldt habe”.3 Er beteuerte, dass er Johann von der Ruhr nicht mehr gesehen habe, nachdem dieser nach Köln zur Gottstracht gewandert sei.
Die Anwaltsschrift dokumentiert den Verlauf der Hinrichtung: Georg Lackum wurde hinaus auf die Richtstätte der Boeler Heide geführt. Nachdem der Scharfrichter ihm befohlen hatte niederzuknien, bat der Verurteilte darum, öffentlich zu beten und der Gemeinde etwas vortragen zu dürfen. In seiner Rede an das umstehende Volk und den Richter nahm er sein Schicksal zwar willentlich an, verkündete aber, daß er die Tat nicht begangen hatte. Er schwor, dass er an dem Mord keine Schuld trug: “will aber den thodt daruff nhemen, daß ich deß Johentgens bloett kheine schuldt habe”.3 Er beteuerte, dass er Johann von der Ruhr nicht mehr gesehen habe, nachdem dieser nach Köln zur Gottstracht gewandert sei.
In seinem öffentlichen Gebet inszenierte sich Georg Lackum als Märtyrer, indem er Gott dafür dankte, daß er ihn für würdig erachtet habe, am Kreuz zu sterben. Er ging noch weiter: Während seiner Rede zeichnete er mit seinem Fuß ein Kreuz in den Boden und kniete sich darauf nieder. Laut der Anwaltsschrift wurde Georg Lackum noch während seines Gebets mit einem Schwert enthauptet. Anschließend wurde der tote Körper auf ein Rad gelegt.4 Aus einem undatiertem Schreiben von Agnes Lackum geht hervor, dass der Kopf anschließend auf einen Pfahl gesteckt wurde.5
Unklar bleiben eine Reihe von Details, so etwa, wie die Hinführung zur Richtstätte verlaufen ist. War Georg Lackum – wie in der Frühen Neuzeit üblich – mit einem Karren dorthin geführt worden? Und von wem war er begleitet worden? Darüber hinaus werden Konflikte zwischen den Vertretern des Landesfürsten und der Gerichtsgemeinde lediglich angedeutet: Der Urteilsträger habe sich geweigert, die Kosten für den Henker zu zahlen und sei daraufhin von dem Drosten eingesperrt worden.6 Man kann nur mutmaßen, daß dieser Streit darauf zurückging, daß dem Wunsch des Amtes auf einen einmonatigen Aufschub der Hinrichtung nicht entsprochen worden war.
Dennoch: Die Akte Lackum informiert uns eindeutig über eine bislang unbekannte Hinrichtungsstätte im Amt Wetter – die Boeler Heide. Regionalgeschichtliche Forschungen haben ergeben, dass als Hinrichtungsort ebenfalls der Hasperbruch, südlich von Wetter, zur Wahl hätte stehen können.7 Die Akte Lackum läßt jedoch erkennen, daß Hinrichtungen auf der Boeler Heide keineswegs ungewöhnlich waren. Der Anwalt der Familie Lackum schrieb, daß man dort Schelme und Diebe „zu exequieren pflegt”.8
Das „Theater des Schreckens“
 Dass der Hinzurichtende sein Wort an die umstehenden Menschen richtete, war in der Frühen Neuzeit nicht ungewöhnlich. Richard van Dülmen hat betont, dass Delinquenten oftmals die Gelegenheit ergriffen, in der Öffentlichkeit Gehör zu finden.9 Nicht nur der frühmoderne Staat, der ein Exempel zur Abschreckung vor weiteren Straftaten statuierte, richtete sich also mit dem Schreckensschaupiel an die Zuschauer, sondern auch die Angeklagten.10 Die sicherlich ergreifende Rede, in der sich Georg Lackum selbst als Märtyrer bezeichnete, verfehlte seine Wirkung auf das umstehende Volk, wie spätere Zeugenverhöre zeigen, keineswegs.
Dass der Hinzurichtende sein Wort an die umstehenden Menschen richtete, war in der Frühen Neuzeit nicht ungewöhnlich. Richard van Dülmen hat betont, dass Delinquenten oftmals die Gelegenheit ergriffen, in der Öffentlichkeit Gehör zu finden.9 Nicht nur der frühmoderne Staat, der ein Exempel zur Abschreckung vor weiteren Straftaten statuierte, richtete sich also mit dem Schreckensschaupiel an die Zuschauer, sondern auch die Angeklagten.10 Die sicherlich ergreifende Rede, in der sich Georg Lackum selbst als Märtyrer bezeichnete, verfehlte seine Wirkung auf das umstehende Volk, wie spätere Zeugenverhöre zeigen, keineswegs.
Dass der Kopf, wie vom Anwalt der Familie Lackum behauptet wurde, noch während des öffentlichen Gebets abgeschlagen wurde, ist allerdings zu hinterfragen: Hätte dies das Volk nicht gegen den Scharfrichter aufgebracht? Allgemein kam es in der Frühen Neuzeit des öfteren dazu, daß der Scharfrichter von der Menge angegriffen wurde, wenn sich während einer Hinrichtung etwas Ungeplantes ereignete.
Wie stand es um die Ehre des Hingerichteten? Einerseits galt die Schwertstrafe als ehrenvoller als eine Hinrichtung am Galgen. Andererseits wurde der tote Körper nach der Enthauptung auf ein Rad gelegt. Dort sollte er für alle sichtbar und zur Schande des Toten verwesen. Georg Lackums Sohn Anton sollte dagegen, dem Urteil zufolge, diese Ehrenstrafe erspart bleiben. Wäre es zu seiner Hinrichtung gekommen, hätte sein Körper danach auf dem Kirchhof „ehrlich“ begraben werden dürfen.11
1 L NRW W, RKG L24, Bd 2, fol 120.
2 L NRW W, RKG L24, Bd 2, fol 120ff.
3 L NRW W, RKG L24, Bd 2, fol 235r.
4 L NRW W, RKG L24, Bd 2, fol 234v und 235r.
5 L NRW W, RKG L24, Bd 2, fol 127v.
6 L NRW W, RKG L24, Bd 2, fol 233.
7Marra, Stephanie u.a.: Eine Hinrichtungsstätte als Schulstandort, in: Einblicke. Zeitschrift für Regionalgeschichte 2 (5 2002), [URL: http://www.historisches-centrum.de/einblicke/02/200206.html, zuletzt abgerufen am 24.08.09]
8L NRW W, RKG L24, Bd.2, fol. 234v.
9Dülmen, Richard van: Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit, München 1995 ( im Folgenden zitiert als: Dülmen, 1995), S. 162.
10Dülmen, 1995, S. 144.
11L NRW W, RKG L24, Bd 2, fol 87.