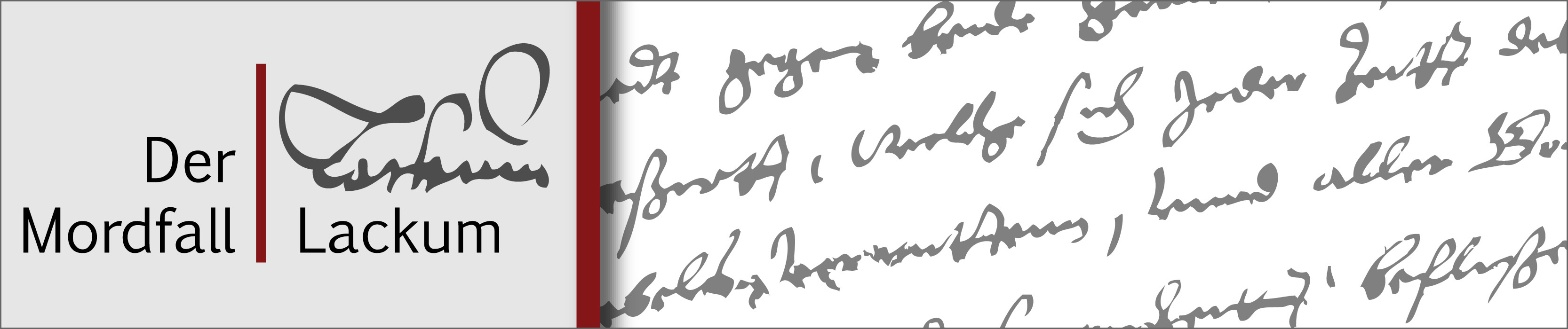Richter, Freischöffen und Anwälte im Mordfall Lackum
von Sascha Kruppa
Das Gericht Wetter
Das Gericht Wetter entstand um 1300. Den Gerichtsbezirk bildeten anfänglich nur die Gemeinden Wetter und Ende. Später kamen dann noch die Gemeinden Wengern, Volmarstein und Herdecke hinzu1. In Bezug auf die Funktionen der Richter kann man sagen, dass sie nicht berechtigt waren, über die Bewohner der Freiheit Wetter ein Urteil zu fällen, soweit es um Angelegenheiten der niederen Gerichtsbarkeit ging, die allein dem Bürgermeister und dem Rat zustand2. Als Vertreter des Landesherren waren sie jedoch sowohl im Amt als auch in der Freiheit Wetter für die hohe Gerichtsbarkeit um Leib und Leben zuständig. Sie hatten für ein ordnungsgemäßes Verfahren zu sorgen und unterstanden dabei dem Drosten.
Der Richter in Wetter um 1590
Die Akte Lackum vermittelt uns zahlreiche Details über das Rechtsleben im Gericht Wetter. Der damalige Richter zu Wetter hieß Dietrich Werning. Er war z.B. dafür zuständig, Zeugen zu verhören und für eine Protokollierung der Ergebnisse zu sorgen. Man kann davon ausgehen, daß er selbst lesen und schreiben konnte. Im Zuge der Rezeption des Römischen Rechts verlangte man von den Richtern, daß sie elementare Verfahrensgrundregeln beherrschten und sich notfalls über juristische Literatur darüber informieren konnten. Andererseits griff Richter Dietrich Werning nicht nur auf gelehrtes Rechtswissen zurück, sondern auch auf mündlich überliefertes: Er veranlasste, dass Jasper von der Ruhr dem Leichnam des Johann von der Ruhr die Hand reichen musste, um die Bahrprobe zu bestehen. Der Richter soll dabei „heftig“ um ein Zeichen gebeten haben.3
darüber informieren konnten. Andererseits griff Richter Dietrich Werning nicht nur auf gelehrtes Rechtswissen zurück, sondern auch auf mündlich überliefertes: Er veranlasste, dass Jasper von der Ruhr dem Leichnam des Johann von der Ruhr die Hand reichen musste, um die Bahrprobe zu bestehen. Der Richter soll dabei „heftig“ um ein Zeichen gebeten haben.3
Richter Werning kam zudem eine wichtige Rolle zu, nachdem Georg Lackum unter der Folter den Mord an Johann von der Ruhr gestanden hatte. Er soll Anton Lackum überredet haben, ebenfalls zu gestehen, da doch sein Vater schon gestanden habe und es sich von daher nicht lohne, sich die Glieder ausreißen zu lassen.4 Darüber hinaus lud er die Freischöffen an das Amtshaus, vor denen das Geständnis von Georg Lackum bekräftigt werden mußte. Nach überliefertem Recht war der Verdächtigte dabei „auf freie Füße“5 zu stellen. Er hatte sein Geständnis somit freiwillig, ohne Zwang, zu wiederholen.
Die Freischöffen
Die Freischöffen des Gerichts Wetter, die, ähnlich wie die Sieben Freien in Bochum, ursprünglich bäuerlicher Herkunft waren und deren Amt noch aus den Zeiten der Vemegerichtsbarkeit stammte, sind namentlich genannt: Es handelte sich um „Diederich Froelingh“, „Johann zu Oestenerde“, „Hermann Tacke“, „Jurgen Becker tho Ermede“, „Borreß vor der Borgh“, „Johann fur der Borgh“ und einen gewissen „Jorgen“.6 Ob Georg Lackum vor ihnen sein Geständnis widerrufen hat, ist allerdings umstritten. Drost Bernhard von Romberg behauptete, daß beide Verdächtigten ihr Geständnis wiederholt und angeboten hatten, mit 300 Talern ihre Tat zu sühnen: 100 Taler an das Hochgericht Schwelm; 100 Taler an das Gericht Hagen und 100 Taler an das Gericht Wetter, den Armen zur Verfügung .7 Er konnte anläßlich der späteren Untersuchungskommission über einen Brief seine Behauptung bekräftigen: In diesem erklärten die sieben Freischöffen, daß beide Verdächtigten bei ihrem Geständnis verblieben waren.8
Wer fällt das Urteil?
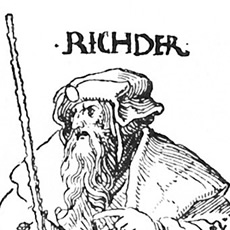 Das weitere Prozedere nach erfolgter Wiederholung des Geständnisses vor den Freischöffen bestand darin, am nächsten Tag einen „Endlichen Gerichtstag“ anzuberaumen. Hier hatte das „gantze Ambt“9 zu erscheinen, was offensichtlich bedeutete, daß sämtliche rechtsfähigen Männer des Amtes Wetter zusammengerufen wurden. An das „gantze Ambt“ wurde nun die Frage gerichtet, ob der Verdächtigte nach Tat und Geständnis zur Leibesstrafe zu verurteilen sei. Anschließend wurde dem „gantzen Ambt“ die Gerichtsakte übergeben – und nach dem Verlesen der Akte fällte das „gantze Ambt“ das Urteil. Ein Urteilträger überbrachte daraufhin dem Richter die Entscheidung, der einen Holzstab über dem Verurteilten zerbrach. Schließlich wurde er dem Scharfrichter zur Vollstreckung übergeben.
Das weitere Prozedere nach erfolgter Wiederholung des Geständnisses vor den Freischöffen bestand darin, am nächsten Tag einen „Endlichen Gerichtstag“ anzuberaumen. Hier hatte das „gantze Ambt“9 zu erscheinen, was offensichtlich bedeutete, daß sämtliche rechtsfähigen Männer des Amtes Wetter zusammengerufen wurden. An das „gantze Ambt“ wurde nun die Frage gerichtet, ob der Verdächtigte nach Tat und Geständnis zur Leibesstrafe zu verurteilen sei. Anschließend wurde dem „gantzen Ambt“ die Gerichtsakte übergeben – und nach dem Verlesen der Akte fällte das „gantze Ambt“ das Urteil. Ein Urteilträger überbrachte daraufhin dem Richter die Entscheidung, der einen Holzstab über dem Verurteilten zerbrach. Schließlich wurde er dem Scharfrichter zur Vollstreckung übergeben.
Bei diesem von den Anwälten der Räte, des Drosten und der Richter beschriebenen allgemeinen Prozedere ist allerdings zu berücksichtigen, daß das eigentliche Urteil, wie im Fall Lackum zu sehen, bereits zuvor von Seiten der Fürstlichen Räte gefällt worden war. Auf dem Endlichen Rechtstag ging es von daher eher um den symbolischen Akt einer Bestätigung des landesherrlichen Urteils durch die Gerichtsgemeinde.
Georg Lackum und Anton Lackum widerriefen nun am Endlichen Gerichtstag, der am 20. November 1591 abgehalten wurde, ihre Geständnisse und sagten vor der Gemeinde aus, daß sie nur aus Furcht vor weiteren Schmerzen unter der Folter gestanden hatten. Die Urteiler und deren Sprecher mit dem Namen „Printz zu Langerfeld“ plädierten danach für einen einmonatigen Aufschub der Vollstreckung.10 Daran zeigt sich, daß die Gerichtsgemeinde in Wetter um 1590, trotz der hohen Bedeutung des landesherrlichen Justizapparates, durchaus noch eine Mitwirkung an der Rechtssprechung beanspruchte und wahrnahm.
Anwälte
 Das Nebeneinander traditioneller und moderner Verfahrenselemente, das den Fall Lackum prägte, wird auch durch die Beteiligung von Anwälten deutlich. Die zahlreichen Prozeßschreiben der Familie Lackum können nur mit juristischer Mitwirkung entstanden sein. Dietrich Lackum hatte nachweislich Kontakte zu einem Notar in Dortmund.11 Nachdem die Angelegenheit an das Reichskammergericht gelangt war, traten Anwälte noch stärker in Erscheinung. Dietrich Lackum und seine Angehörigen wurden hier vertreten durch Jacob Streit als Prokurator und Joachim Toelmann (auch Telemann) als Advokaten. Für die Beklagten trat Andreas Pfeffer als Prokurator auf.
Das Nebeneinander traditioneller und moderner Verfahrenselemente, das den Fall Lackum prägte, wird auch durch die Beteiligung von Anwälten deutlich. Die zahlreichen Prozeßschreiben der Familie Lackum können nur mit juristischer Mitwirkung entstanden sein. Dietrich Lackum hatte nachweislich Kontakte zu einem Notar in Dortmund.11 Nachdem die Angelegenheit an das Reichskammergericht gelangt war, traten Anwälte noch stärker in Erscheinung. Dietrich Lackum und seine Angehörigen wurden hier vertreten durch Jacob Streit als Prokurator und Joachim Toelmann (auch Telemann) als Advokaten. Für die Beklagten trat Andreas Pfeffer als Prokurator auf.
1 Rudolf Buschmann: Das Gericht Wetter, in: Märkisches Jahrbuch für Geschichte 13 (1898/1899), S. 107-132 (im Folgenden zitiert als: Buschmann, 1898), hier S. 114.
2 Buschmann, 1898, S. 114.
3 LAV NRW W RKG L 24, Bd. 2, fol. 61.
4 LAV NRW W RKG L 24, Bd. 2, fol. 174.
5 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 1, fol. 60.
6 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 2, fol. 255.
7 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 2, fol. 177.
8 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 2, fol. 246.
9 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 1, fol. 60.
10 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 2, fol. 89ff.
11 LAV NRW W, RKG L 24, Bd. 1, fol. 46ff.